Sollst du bei der Preisgestaltung als Fotograf Nutzungsrechte für deine Fotos berechnen? Und wenn ja, wie gehst du vor?
Was sind Nutzungsrechte?
Als Fotograf behältst du die Urheberrechte an deinen Fotos auch dann, wenn du für einen Kunden arbeitest und dafür bezahlt wirst.
Die Nutzungsrechte dagegen überträgst du auf den Kunden (Siehe UrhG §31).
Nutzungsrechte für Fotos berechnen
Du kannst als Fotograf das Einräumen der Nutzungsrechte zusätzlich zum Shooting-Honorar anbieten.
Vereinfacht könnte das so aussehen:
| Shooting-Honorar (…. genaue Beschreibung …) | 1000 Euro |
| Spesen | 200 Euro |
| Nutzungsrechte (… genauer Umfang …) | 700 Euro |
| Gesamt | 1.900 Euro |
Möglicher Einwand des Kunden
Fotografen hören gelegentlich den Einwand: „Warum soll ich denn jetzt noch Nutzungsrechte für die Fotos bezahlen? Ich habe doch bereits das Shooting bezahlt? Wenn ich mir Socken kaufe, darf ich die doch auch so oft anziehen, wie ich möchte. Warum soll das bei Fotos anders sein?!“
Fotos sind aber keine Socken, sondern Ergebnis einer kreativen Arbeit und daher ist die Socken-Analogie fehl am Platz.
Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg
Über die Bezahlung von Nutzungsrechten wird der Kreative am wirtschaftlichen Erfolg der kreativen Leistung beteiligt. Das ist keine unverschämte Forderung von Kreativen, sondern gesetzlich so vorgesehen.
Abrechnung von Nutzungsrechten ist marktüblich
Gelegentlich wird behauptet: In der heutigen Zeit zahle niemand mehr Nutzungshonorare. Lass dich von einem solchen Argument nicht irritieren, denn das entspricht nicht der Realität.
Nutzungsabhängige Honorare sind fester Bestandteil der Kalkulation professionell arbeitender Fotografen, auch wenn sie nicht in jedem Fall separat ausgewiesen werden.
Auch das Argument: „Die anderen Fotografen, mit denen wir arbeiten, berechnen keine Nutzungshonorare.“ muss nicht unbedingt dazu führen, dass du ebenfalls darauf verzichtest.
Nutzungsrechte geben den Kunden Sicherheit
Wenn du als Fotograf ausdrücklich erwähnst (und auf der Rechnung ausweist), welche Nutzungsrechte du dem Kunden einräumst, ist dieser bei der Nutzung auf der sicheren Seite.
Im anderen Fall würden sich nach §31 (5) UrhG Unsicherheiten ergeben, die nicht im Interesse des Kunden sein können.
Kriterien zur Kalkulation der Nutzungsentgelte
Sinnvoll (für beide Seiten) ist es, genau die Nutzungsrechte einzuräumen, die der Kunde braucht. Die Frage: „Wofür möchten sie die Fotos verwenden?“ ist also eine wichtige Grundlage für die anschließende Angebotserstellung.
Ausschlaggebende Kriterien für die Kalkulation können sein:
- Dauer der Nutzung
- Veröffentlichungsmedium
- Größe der Abbildung
- Auflage
- Verbreitungsgebiet
Höhe der Nutzungsentgelte
Die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing bietet die MFM-Liste an, in der die marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte aufgelistet sind. Damit kannst du die Nutzungsrechte für Fotos berechnen.
Diese Liste entsteht jedes Jahr neu auf Basis einer Markterhebung realer Aufträge und ist eine wertvolle Hilfe bei der Preisgestaltung für Fotografen.

Darüber hinaus gibt es unter anderem den Tarifvertrag für freie Journalisten, die Tarife der Verwertungsgesellschafft Bild-Kunst und den Vergütungstarifvertrag Design. Sie sind ebenfalls in der MFM-Publikation dargestellt.
Total Buy Out
Die Einräumung unbeschränkter Nutzungsrechte (Total Buy Out) ist zwar praktisch, aber in den wenigsten Fällen sinnvoll.
Laut RA Viola Lachmann sind Total Buy Out Verträge rechtlich möglich, müssen aber nach Entscheidung des BGH angemessen hoch vergütet werden.
Daher wird ein Kunde, der auf unbeschränkten Nutzungsrechten besteht, ein unnötig hohes Honorar bezahlen müssen.

Privatkunden
Fotografen, die für Privatkunden arbeiten, werden Nutzungsrechte nicht separat auf der Rechnung ausweisen.
Sinnvoll ist es aber, festzulegen, für welchen Einsatzzweck die Fotos verwendet werden dürfen und für welchen nicht.
Beliebte Fragestellungen sind:
- Darf der Privatkunde sein Bewerbungsfoto auch auf der Firmenwebsite seines Arbeitgebers nutzen?
- Darf das Hochzeitspaar die Hochzeitsfotos an weitere Dienstleister (Catering, Hochzeitslocation, …) weitergeben, damit diese die Bilder auf deren Website nutzen?
Einfache Regelung für Gelegenheitskunden
Businesskunden, die nur selten einen Fotografen beauftragen, können in der Regel mit dem Begriff „Nutzungsrechte“ wenig anfangen.
In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine sehr einfache pauschale Regelung zu finden und ihnen die Angst vor eventuellen Abmahnungen zu nehmen.
Professionelle Kunden
Professionelle Kunden, also Werbeagenturen oder Marketing-Abteilungen großer Firmen sind es gewohnt, über Nutzungshonorare zu sprechen.
In diesen Fällen wirst du als Fotograf die eingeräumten Nutzungsrechte sehr genau beschreiben.
Sind die Aufnahmen beispielsweise zuerst nur für eine kleine Veröffentlichung vorgesehen, werden aber anschließend doch für eine überregionale Kampagne eingesetzt, ist es angemessen, dass du als Fotograf an dieser erweiterten Nutzung durch ein entsprechend höheres Honorar beteiligt wirst.
Nutzungshonorare im Angebot
Die Berechnung von Nutzungshonoraren sollte bereits im Angebot deutlich aufgeführt sein, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Du als Fotograf hast die Aufgabe, deinen Kunden in seinem Sinne zu beraten und ein Angebot zu machen, mit dem er glücklich wird und das dir ein faires Honorar bringt.
Zusammenfassung
Die Berechnung von Nutzungshonoraren gehört zum Handwerkszeug für alle professionellen Fotografen.
Für „kleinere“ Kunden kann ein pauschales Nutzungshonorar vereinbart werden. Ist eine umfangreiche Nutzung zu erwarten, ist die MfM-Liste ein guter Anhaltspunkt.



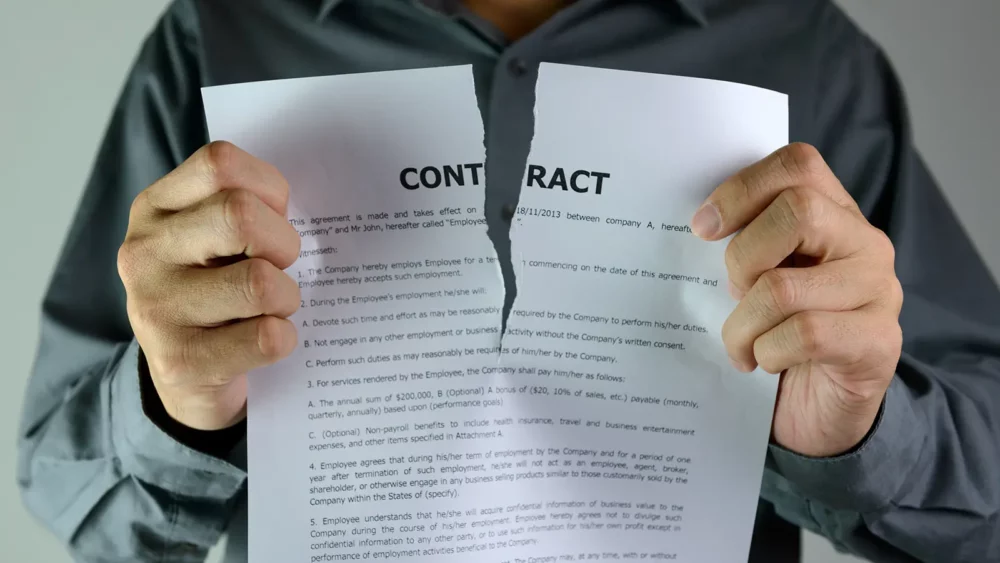

Sehr spannender Artikel auch für mich als interessierter Hobbyfotograf, vielen Dank dafür.
Mal andersherum gefragt – wie viel sollten mich als Privatkunde die Nutzungsrechte eines Portraitfotos für Social Media und ggf. berufliche Zwecke (Lebenslauf, Firmenwebsite meines Arbeitgebers) maximal kosten? Eine pauschale Aussage ist hier sicherlich schwierig, jedoch würde ich mich über ungefähre Spannbreiten freuen.
Vielen Dank!
Vielen Dank, Marcel.
Du meinst, das Foto ist bereits bezahlt und jetzt werden zusätzlich die beschriebenen (überschaubaren) Nutzungsrechte gewünscht?
Das bieten die meisten Fotografen im hohen zweistelligen Eurobereich an.
Vielen Dank für diesen informativen Beitrag. Als Hobbyfotograf habe ich bisher damit noch keine Berührungspunkte gehabt, es schadet aber nicht, zu wissen, wo man sich entsprechend informieren kann, deswegen werde ich diesen Beitrag auf meine Bookmark Liste setzen.
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Michael,
immer mal wieder ein Thema, dass mit Diskussionen verbunden ist. Bei Agenturen kein Problem, aber bei kleineren Firmen muss man erst erklären, was und wofür ein Nutzungsrecht ist. Da sind solche Artikel immer wieder interessant zu lesen, wie man gegenüber dem Kunden argumentieren kann. Dankeschön!
Viele Grüße aus Lübeck
André
Vielen Dank für diesen Artikel. Ich habe viele interessante Informationen gefunden.